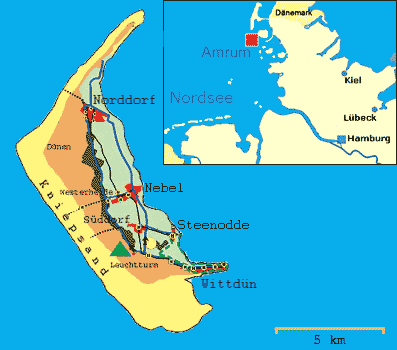|
Europas breitester Badestrand
Der sogenannte Kniepsand ist eine Sandbank, die der Insel Amrum direkt
parallel vorgelagert ist und gilt als der breiteste Badestrand Europas.
Die Sedimente werden vorwiegend aus westlicher und südwestlicher
Richtung antransportiert, stammen also nicht, wie oft angenommen, von
der Sylter Küste. In der Vergangenheit hat die Sandbank oft ihre
Form und Position geändert und "wandert" in jüngster
Zeit langsam in nördlicher Richtung.

Kniepsand

Leuchturm auf Amrum
Geologie
Eiszeiten und Meeresspiegelschwankungen
Die geologisch-morphologischen Verhältnisse der nordfriesischen
Inseln wurden ganz wesentlich durch die letzten Eiszeiten
(Elster - Saale - Weichsel) geprägt.
Wärend der Kaltzeiten (Glazial) rückten die Gletscher aus dem
skandinavischen Raum vor. Durch die Vereisung wurden enorme Wassermengen
der Meere gebunden, was im Laufe der Zeit zu einer drastischen Absenkung
des Meeresspiegels führte. So lag während der Hauptvereisungsphasen
die Nordseeküste aufgrund der Regression (Meeresrückzug) etwa
in Höhe der Dogger-Bank.
Erneute Transgressionen (Meereseinbrüche) erfolgten in den Zwischeneiszeiten,
auch Interglazial genannt. Die nachstehende Abbildung zeigt die eustatischen
Meeresspiegelschwankungen im Zeitraum Ende der Elster-Kaltzeit bis heute.
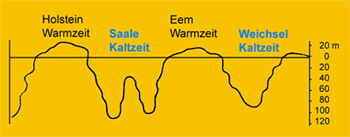 |
Eustatische Meeresspiegelschwankungen im Pleistozän und Holozän
- nach Woldstedt, 1969. Quelle: Schmidt, K. (1978) |
Geht man weiter in der Erdgeschichte zurück, so wird deutlich, dass
es während früherer Vereisungsperioden eustatische
Meeresspiegelschwankungen gab, die weit mehr als 100 m betrugen. Der Tiefstand
von - 250 m gegenüber heutigem Niveau im Oligozän bleibt allerdings
rätselhaft, da dies allein mit einer Vereisung nicht erklärt
werden kann (Füchtbauer, 1988). Wahrscheinlich waren auch großräumige
tektonische Vorgänge an solchen Meeresspiegelschwankungen beteiligt
(tektono-eustatische Meeresspiegelschwankungen).
Vail (1977) gibt einen Höchststand von 350 m höher als heute
für das Ende der Kreidzeit an, Seyfried & Leinfelder (1993) hingegen
nennen einen Schwankungsbereich von +270 m und -150 m gegenüber dem heutigen
Niveau.
die höchste
Lage, am Ende der Kreidezeit:
|
350 m höher
als heute
|
| die tiefste Lage, im Mitteloligozän: |
250 m tiefer als heute
|
zu Beginn des Jura und im
Zechstein:
|
150 m tiefer als heute
|
| im Obermiozän: |
200 m tiefer als heute. |
Quelle: Füchtbauer (1988)- Angaben nach VAIL et.al.
(1977)
Zurück ins Pleistozän. In diesem Zeitabschnitt der Erdgeschichte
waren die drei Inselkerne von Amrum, Föhr und Sylt noch miteinander
verbunden und bildeten das sogenannte "Westland". Während
des Eem-Interglazials und der Bildung des Eem-Meeres durch die abschmelzenden
Eismassen, ragte diese Landmasse aus dem Meer heraus.
Vor ca. 70.000 Jahren, während der letzten Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit),
sank der Meeresspiegel erneut um einen Betrag von ca. 100 m gegenüber
dem heutigen Niveau ab.
Am Ende des Pleistozäns kam es schließlich zur Aufspaltung
des "Westlandes". Zwischen den heutigen Inseln Amrum und Föhr
entstand infolge des Abschmelzens der Inlandseismassen eine Schmelzwasserrinne.
Der erneute Meeresspiegelanstieg im Holozän durch die Flandrische
und Dünkirchener Transgression auf das heutige Niveau führte
schließlich zur endgültigen Teilung des ursprünglich zusammenhängenden
"Westlandes". Es entstanden die Inseln Amrum, Föhr und
Sylt. Dementsprechend besitzen auch alle drei Inseln einen pleistozänen
Untergrund, der sogenannte Geestkern,
der von Marschland umgeben ist. Aus diesem Grunde werden diese Inseln
auch als Geestinseln bezeichnet.
Die pleistozänen Sedimente auf Amrum bestehen überwiegend aus
Sand- und Kiesschichten sowie häufig eingeschaltetem Geschiebe. Sie
wurden während der Elster- und Saaleeiszeit abgelagert. Die letzte
Kaltperiode, die Weichseleiszeit, hat auf Amrum keine Ablagerungen hinterlassen,
da die Gletscher nicht mehr bis in dieses Gebiet vordringen konnten.
Die Sande und Kiese, mit Mächtigkeiten zwischen ca. 20 und 30 m,
bedecken fast die gesamt Insel. Die Herkunft der charakteristischen Geschiebe,
wie z.B. Rhombenporphyr oder Rapakiwi-Granit, läßt sich eindeutig
den skandinavischen Ländern zuordnen.
Das älteste anstehende Gestein, einen Limonitsandstein aus dem Tertiär,
findet man am Steenodder Kliff, ganz im Norden der Insel. Es handelt sich
sehr wahrscheinlich um eine in situ-Bildung (am Ort entstanden).
Von besonderer Bedeutung für die heutige Gestalt und Position der
Inseln waren die beiden Sturmfluten von 1362 (Mannsdränke) und von
1634 (Marcellus-Flut), die mit katastrophalen Landverlusten verbunden
waren.
An vielen Stellen waren infolge von Austorfung zur Gewinnung von Salz
größere Senken entstanden, so dass das Meer bei Sturmflut leichtes
Spiel hatte. Erst als die alten, maroden Deiche im Nachhinein verbessert
und erhöht wurden, konnten die Landverluste gestoppt und wieder Neuland
gewonnen werden.
Das Watt - eine von Ebbe und Flut geprägte
Landschaft
Wattflächen bilden sich im allgemeinen im Randbereich
von Lagunen, hinter Barriere-Inseln, in Ästuaren und in Deltas. An
der deutschen Nordseeküste konnten Wattflächen durch eine Kombination
aus dem regelmäßigen Wechsel von Ebbe und Flut (Tidenhub), der wellenbrechenden
Wirkung der vorgelagerten friesischen Inseln sowie dem flachen Abfall
der Küste entstehen. Dieser vor starker Brandung relativ sichere Lebensraum
wird durch den regelmäßigen Wechsel von Überflutung und Trockenfallen
charakterisiert.
Näheres zum Thema Gezeiten
erfahren Sie hier >>.
Die Wattgebiete lassen sich in drei Zonen einteilen:
Supralitoral
|
Bereich oberhalb
der Hochwasserlinie,
bei Sturmflut teilweise überschwemmte Fläche
|
| Eulitoral |
Bereich zwischen
Hochwasser- und Niedrigwasserlinie, trockenfallender Bereich = Watt
|
Sublitoral
|
Bereich unterhalb der Niedrigwasserlinie |
Der Begriff litoral bezeichnet die Vorgänge, Kräfte und Formen,
die an einer Küste auftreten.
Besonders markante morphologische Merkmale in den Wattgebieten sind die
Priele. Diese Kanalsysteme regulieren den Zufluß und Abfluß
im Watt und bilden sich vorwiegend durch den Ebbstrom.
Je nach Strömungsintensität können Priele dm- bis m-tiefe
Rinnen ins Watt einschneiden. Durch Erosion und Sedimentation ändern
die Priele mehr oder weniger ständig ihren Verlauf und sind damit
ganz wesentlich für die Umlagerung der Wattsedimente verantwortlich.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Rinnenverlagerungen von 100 m im Jahr
die Regel sind. Dieser Prozess bewirkt auch eine Abfolge von schräggeschichteten
Lamellen aus sandig-schlickigem Material.
Die Wattsedimente bestehen aus einem Sand-Silt-Ton-Gemisch.
Das Gemisch aus vorwiegend feinen Partikeln wird gewöhnlich als Schlick
bezeichnet. Je nach Strömungsgeschwindigkeiten des Wassers lagern
sich unterschiedliche Wattsedimente mit entsprechenden Anteilen der jeweiligen
Kornfraktion ab. Man unterscheidet daher Sand-, Misch- und Schlickwatt.
In der nachstehenden Abbildung sind die Korngrößenanalysen
von mehreren hundert Wattsedimentproben Ostfrieslands im ternären
Diagramm von Sand, Silt und Ton mit der entsprechenden Zuordnung des Watt-Typs
dargestellt. Bei einem Ton-Silt-Anteil von mehr als 85% des Sedimentgemisches
spricht man auch von einem "fetten Schlickwatt".
| |
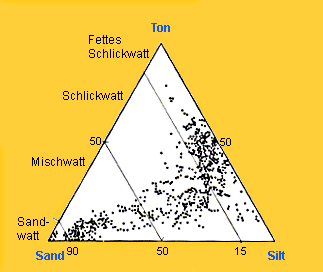 |
Korngrößenverteilung von Wattsedimenten
Ostfrieslands.
aus: Füchtbauer, 1988 - Abbildung modifiziert.
Sand = 0,063 mm bis 2 mm
Silt = 0,002 mm bis 0,063 mm
Ton = < 0,002 mm
|
Im Gegensatz zu einem normalen Küstenprofil, wo mit zunehmender
Entfernung vom Land die Korngrößen der Sedimente abnehmen (z.B.
Tiefseeton), werden im Watt feinste Sedimente landnah abgelagert.
Die feinen Korngrößen lagern sich bei auflaufendem Wasser,
kurz vor dem Stillstand der Strömung, im obersten Bereich des Watts
ab. Im unteren Bereich hingegen, wo stärkere Strömungsverhältnisse
herrschen, werden vorwiegend Sande sedimentiert.
Lebensraum Watt
Das Wattenmeer bietet zwar relativ
wenigen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, allerdings kommen diese
in großer Anzahl vor. Diese Artenarmut und der gleichzeitige Individuenreichtung
ist hauptsächlich auf ständig wechselnde Milieubedingungen im
Ökosystem zurückzuführen.
Ebbe und Flut und die damit verbundenen Schwankungen
in der Salinität, Feuchtigkeit, Temperatur und dem Nahrungsangebot
erfordern eine spezielle Anpassung von Fauna und Flora.
Die wichtigsten Lebewesen im Wattboden sind vor allem Kieselalgen (Diatomeen),
Muscheln, Schnecken, Krebse und Würmer. Aufgrund der großen
Anzahl an Individuen ist das Watt tatsächlich eines der biologisch
produktivsten Lebensräume überhaupt. Hinzu kommt, dass der Strand,
die Dünengebiete und die Salzwiesen Lebensraum für zahlreiche
Vogelarten ist.
Wattwurm (Arenicola
marina)
Pygospiowurm (Pygospio elegans)
Schlickkrebs (Corophium volutator)
Wattschnecke (Hydrobia ulvae)
Strandschnecke (Littorinalittorea)
Pfeffermuschel (Scrobicularia plana)
Miesmuschel (Mytilus edulis)
|
|
Kotpillenwurm (Heteromastus
filiformis)
Herzmuschel (Cerastoderma edule)
Sandklaffmuschel (Mya arenaria)
Plattmuschel (Macoma baltica)
Seeringelwurm (Nereis sp.)
Bäumchenröhrenwurm (Lanice conchilega)
|
Typische Makroorganismen des Wattenmeeres. (Quelle: Hoffmann
& Deicke).
Besonders die Kieselalgen findet man in großer Anzahl. In einem
Kubikzentimeter Wattsediment können bis zu einer Million dieser Organismen
auftreten. Diese Einzeller bestehen aus einem Zellkern und einer silikatischen
Hülle. Ihre Größe reicht von einem tausendstel Millimeter
(= 1µm) bis zu einem oder zwei mm. Wegen ihrer geringen Größe
sind sie im Watt mit dem Auge nur als rotbraune Flecken zu erkennen. Unter
dem Mikroskop hingegen erschließt sich einem die außerordentliche
Schönheit und Formenvielfalt dieser Organismen. Kieselalgen stehen
am Anfang der Nahrungskette, sind also Grundlage für die Existenz
der höheren Lebewesen und werden von Würmern, Schnecken und
Fischen gefressen.
| |
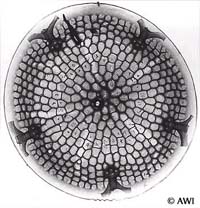 |
Kieselalge (Foto
Alfred Wegener Institut, Bremerhaven - mit freundlicher Genehmigung)
Das AWI
besitzt eine der größten Kieselalgensammlungen der Welt. Es sind etwa
100.000 Arten bekannt. |
M.Wipki
Literatur:
Füchtbauer, H. (Hrsg.), (1988): Sedimente und
Sedimentgesteine, Stuttgart (Schweizerbart).
Geschwinder, M. , Die Entstehungsgeschichte der Insel Amrum.
Henningsen, D.(1981): Einführung in die Geologie der Bundesrepublik
Deutschland, Stuttgart (Enke).
Hoffmann, F. & Deicke, M.: Hallig Hooge 2002, Georg-August-Universität,
Göttingen.
Murawski, H. (1983): Geologisches Wörterbuch, Stuttgart (Enke).
Pott, E. & Küpker, W. (1999): Der große BLV Naturführer
Nordsee und Ostsee, München (BLV).
Schmidt, K. (1978): Erdgeschichte, Berlin (de Gruyter).
Seyfried, H. & Leinfelder, R., Meeresspiegelschwankungen - Ursachen,
Folgen, Wechselwirkungen - Teil 2 - Internetveröffentlichung- bBasierend
auf einem gleichlautenden, in "Wechselwirkungen"- Jahrbuch 1992 der Universität
Stuttgart (S. 112-127) erschienenen Artikel (1993 publiziert).
Fotos:
P. Nierychlo, U. Reddmann
|