|
Leben am Tiefsee-Schlammvulkan
|
|
In 1250 Metern Wassertiefe
fließen statt Lava Schlamm und Methan aus dem Tiefsee-Schlammvulkan
Haakon-Mosby. Der nach dem norwegischen Ozeanographen
benannte Schlammvulkan wurde 1990 von einem internationalen
Forscherteam in der Barentssee entdeckt. Aus dem Zentrum
des etwa einen Quadratkilometer großen, aber nur maximal
zehn Meter hohen Vulkans steigt Gas aus rund zwei Kilometern
Tiefe unterhalb des Meeresbodens auf.
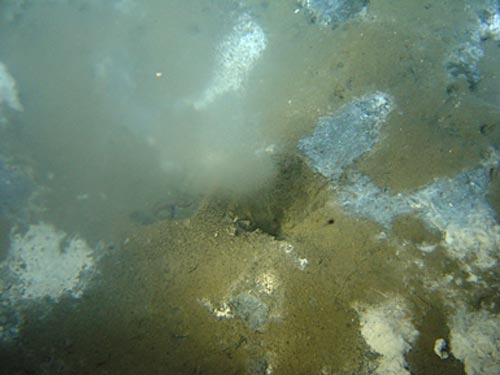
Austritt von methanreichen Fluiden
aus dem Schlammvulkan Haakon Mosby im Nordpolarmeer. Die
hellen Flecken sind Matten von schwefeloxidierenden Bakterien
auf dem Sediment. Bildquelle: IFREMER/AWI
Der Schlammvulkan
wird in drei stark von einander abgegrenzte ringförmige
Zonen - Zentrum, mittlerer und äußerer Ring - aufgeteilt.
Die drei ansonsten völlig unterschiedlich besiedelten
Zonen haben eines gemeinsam: die dort in -1 Grad Celsius
kaltem Wasser lebenden Mikroorganismen ernähren sich in
allen drei Zonen hauptsächlich von Methan. An der Oberfläche
des Zentrums setzen bisher unbekannte Bakterien das Methan
mit Sauerstoff um, während in den etwas tieferen Schichten
der mittleren Zone große Mengen einer Gruppe von Archaea
in einer Symbiose mit Bakterien das Methan mit Sulfat
veratmen, ohne dafür Sauerstoff zu benötigen. Der Großteil
des Methans wird nicht im Zentrum, sondern im äußeren
Ring des Vulkans veratmet. Ein Grund dafür ist, dass hier
die gashaltigen Fluide deutlich langsamer aufsteigen.
Bisher war man davon ausgegangen, dass in Gebieten mit
hohem Druchfluss an Methan auch deutlich mehr Methan zehrende
Mikroorganismen leben. In der arktischen Tiefsee ist offensichtlich
das Gegenteil der Fall: Am Haakon Mosby wird das meiste
Gas in der äußeren Vulkanzone verbraucht. Insgesamt sind
das nur rund 40 Prozent des austretenden Methans, während
an manchen Methanquellen im Ozean das gesamte austretende
Gas veratmet wird. Das im Zentrum und im mittleren Ring
schnell aus dem Boden nach oben strömende Wasser enthält
weder Sauerstoff noch Sulfat. In der äußeren Zone des
Vulkans allerdings wachsen Röhrenwürmer, die bis zu 60
Zentimeter tief in den Boden reichen. Sie pumpen aktiv
das Meerwasser und damit auch Sulfat in tiefere Bodenschichten.
Die an ihren Wurzeln lebenden Organismen können dank dieser
lebenden Pumpen auch dort Methan umsetzen, wo es normalerweise
kaum möglich wäre. Dort wurde auch der höchste Methanumsatz
gefunden, so dass fast kein Gas ins Meer entweicht. Das
zeigt, dass wirksame biologische Filter für Treibhausgase
erst durch das komplexe Zusammenspiel von Lebensgemeinschaften
im Meeresboden entstehen können.
Die Ergebnisse dieser im Rahmen des Programms GEOTECHNOLOGIEN
von Dr. Helge Niemann vom Max-Planck-Institut für marine
Mikrobiologie in Bremen und Dr. Tina Lösekann von der
Stanford University School of Medicine in Palo Alto durchgeführten
Untersuchungen sind am 19.10.2006 im Wissenschaftsmagazin
Nature veröffentlicht worden (H. Niemann, T. Lösekann,
D. de Beer, M. Elvert, T. Nadalig, K. Knittel, R. Amann,
E.J. Sauter, M. Schlüter, M. Klages, J.P. Foucher, A.
Boetius: Novel microbial communities of the Haakon Mosby
mud volcano and their role as a methane sink).
Monika Huch, Adelheidsdorf
