6.2 Sekundäre Kaoline
Untersucht wurden fluviatil-limnische Kaoline aus dem Gedaref-Gebiet sowie fluviatile kaolinitische Sand- und Siltsteine vom Jebel Umm Ali und von Gureif in der Nähe von Salawa, am W-Ufer des Nils (SCHMIDT & STÖRR 1991, SCHMIDT 1992, STÖRR et al. 1993). Unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verwendung der Kaoline wurden von diesen Vorkommen auch mehrere Großproben für technologische Tests genommen. Eine smektitreiche Probe, die einem kleineren Vorkommen bei Hashaba (Gedaref-Gebiet) entstammt, wurde zum Zweck einer eventuellen Beimischung zu den Kaolinen in die Untersuchungen miteinbezogen.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgt die Darstellung der Untersuchungsergebnisse für die unterschiedlichen Kaolintypen gemeinsam. Die fünf Großproben lassen sich wie folgt charakterisieren:
| a) | Magarif, nördliches Setitufer (Gedaref-Gebiet): Stark silifizierter hellgrauer Kaolin. Sedimentationsmilieu: fluviatil-limnisch. |
| b) | Hashaba, südliches Setitufer (Gedaref-Gebiet): Weniger stark silifizierter weißgrauer Kaolin. Sedimentationsmilieu: fluviatil-limnisch. |
| c) | Jebel Umm Ali: Gering verfestigter weißgrauer Kaolin mit geringen Hämatitanteilen, schlämmbar. Sedimentationsmilieu: fluviatil, Hochflutablagerung. |
| d) | Salawa (Gureif): Siltiger weißer Kaolin, schlämmbar. Sedimentationsmilieu: fluviatil, Hochflutablagerung. |
| e) | Hashaba, südliches Setitufer (Gedaref-Gebiet): Grüner smektitischer Ton. Sedimentationsmilieu: fluviatil-limnisch. |
Im Rahmen der Voruntersuchungen wurden die jeweiligen Proben auf ihre Dispergierbarkeit überprüft, was für eine erste Bewertung bzw. die Applikation der Kaoline von entscheidender Bedeutung ist. Wie zu erwarten war, zeigen die silifizierten Proben aus dem Gedaref-Gebiet im Vergleich zu den übrigen Kaolinen eine sehr geringe Dispergierbarkeit. Das bedeutet eine erhebliche Einschränkung der Applikationsmöglichkeiten, da eine Abreicherung der Schadstoffe bzw. Anreicherung des Kaolinitanteils nur sehr begrenzt möglich ist.
Ferner wurden die Großproben trocken und naß gemahlen und die dadurch erzeugten Fraktionen untersucht. Von besonderer Bedeutung für die technische Weiterverarbeitung ist dabei die Kornfraktion < 63µm. Bei trockener Mahlung zeigen die Kaoline von Salawa und Umm Ali für diese Fraktion erhöhte Anteile, im Falle einer nassen Mahlung trifft dies auch auf die weniger silifizierte Probe von Hashaba zu (Abb. 109).
Um die Eignung für die Herstellung keramischer Produkte zu überprüfen, wurden die ausgewählten vier Kaolintypen mit unterschiedlichen Anteilen an Feldspat, smektitischem Ton (Hashaba-Ton) sowie teilweise mit Soda vermischt und bei Temperaturen zwischen 1100 °C und 1200 °C mit variablen Haltezeiten gebrannt. Als Maß für die erreichte Sinterung wurde die Wasseraufnahme der Versuchskörper nach dem Brand bestimmt. In den Mischungen zeigt der weniger silifizierte Kaolin von Hashaba und der Kaolin vom Jebel Umm Ali die stärkste Sinterung. Die Zugabe des smektitischen Hashaba-Tons erwies sich als nicht vorteilhaft. Eine Reihe weiterer technologischer Parameter, wie Brennfarbe, Plastizität, Trockenbiegefestigkeit, Brennschwindung und Sinterpunkt, wurden qualitativ im Vergleich bestimmt (Tab. 34).
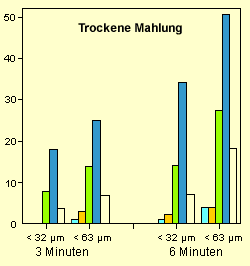 |
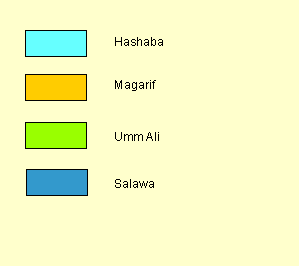 |
|
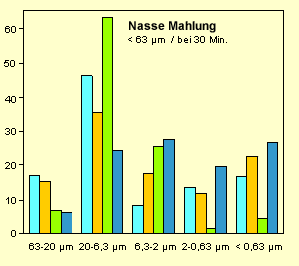 |
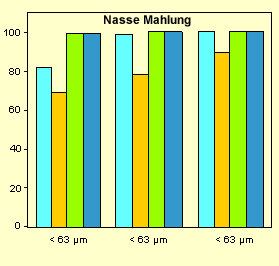 |
Abb. 109: Anteile für die jeweiligen Fraktionen nach trockener und nasser Mahlung der Großproben in einer Kugelmühle. Trockene Mahlung nach einer Grobzerkleinerung Fraktion 630-1000 µm, nasse Mahlung nach Grobzerkleinerung Fraktion < 315 µm. Korngrößenbestimmung < 63 µm mit Sedigraph 500. Angaben in Masse-% (nach STÖRR et al. 1993).
|
Magarif
|
Hashaba
|
Salawa
|
J. Umm Ali
|
|
| Dispergierbarkeit |
sehr gering
|
gering
|
gut
|
gut
|
| Brennfarbe |
gelblich-grau
|
gelblich-grau
|
grau-weiß
|
gelblich-grau
|
| Plastizität |
gering
|
mittel
|
mittel
|
gut
|
| Trockenbiegefestigkeit |
gering
|
mittel
|
mittel
|
gut
|
| Brennschwindung |
mittel
|
hoch
|
niedrig
|
niedrig
|
| Sinterpunkt (Ausgangsmaterial) |
1350 °C
|
1450 °C
|
1630 °C
|
1400 °C
|
Tab. 34: Technologische Charakterisierung der vier Kaolintypen.
Faßt man die Ergebnisse der Untersuchungen zusammen, so sind sämtliche vier Kaolinvarietäten im Prinzip dafür geeignet, um daraus, z.B. im Stapelbrandverfahren Wand- und Bodenfliesen herzustellen. Legt man die technologischen Daten zugrunde, so müßten für die Fliesenherstellung die Kaoline von Salawa und Umm Ali den Gedaref-Kaolinen (Magarif, Hashaba) vorgezogen werden. Außerdem eignen sich sämtliche Kaoline für die Herstellung von Steingutgeschirr oder auch Drainagerohre sowie Produkte für die Baustoffindustrie. Für Sanitärkeramik eignen sich vornehmlich die gut schlämmbaren Kaoline von Umm Ali und Salawa, bei denen eine Schadstoffabreicherung durch Naßaufbereitung möglich ist, um den Weißgrad zu erhöhen. Nach den in der Keramikindustrie üblichen Verarbeitungsmethoden lassen sich die silifizierten Gedaref-Kaoline hingegen nach Aufmahlung nicht ohne eine zusätzliche, aufwendige Aufbereitung für diesen Zweck verwenden.
Die geschätzten potentiellen Vorräte der Gedaref-Kaoline betragen allein für das Setit-Gebiet mehrere Milliarden Tonnen. In Anbetracht der großflächigen Verbreitung der Kaoline wären die Vorräte über einen sehr langen Zeitraum gesichert. Der Kaolin kann im Tagebau gewonnen werden, da oft keine oder nur eine geringmächtige Überdeckung vorhanden ist. Wichtige infrastrukturelle Vorteile wären hier: ausreichende Mengen an Wasser (Setit und Atbara) für die Aufbereitung, eine mögliche Nutzung der Wasserwege für den Transport sowie die Nähe zur Straße und Bahn.
Die potentiellen Vorräte der "Hochflut-Kaoline" vom Jebel Umm Ali sind dagegen vergleichsweise gering. Eine Gewinnung der Kaoline ist aufgrund der Überlagerung durch Sandsteine im Tagebau nur bereichsweise möglich. Ein Tiefbau wäre jedoch nur mit einem erhöhten Kostenaufwand möglich. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit dürfte somit eine intensive Nutzung dieses Vorkommens nicht möglich sein.
Für die "Hochflut-Kaoline" westlich von Omdurman wurden bislang keine eigenen anwendungstechnischen Untersuchungen durchgeführt. Nach Angaben von BRINKMANN (1985), der die gering verfestigten Kaoline an den Merkhiyat-Bergen untersuchte, lassen sich diese prinzipiell für die Herstellung von Wandfliesen, Steingut, Steinzeug, Sanitärkeramik und Porzellan verwenden. Voraussetzung für den feinkeramischen Bereich ist allerdings eine Naßaufbereitung und eine Beimengung plastischen Tons. Die Verwendung als Papierkaolin muß aufgrund der niedrigen Remissionsgrade (52,1 - 60,4) ausgeschlossen werden, sofern keine chemische Nachbehandlung beispielsweise mit Dithionit erfolgt. Über die Mächtigkeiten bzw. laterale Ausdehnung dieses Vorkommens existieren keine detaillierten Informationen. Bei einer grobgeschätzten flächenhaften Ausdehnung von 10 km x 1 km und Mächtigkeiten von 2 - 5 m ergeben sich potentielle Vorräte in der Größenordnung von ca. 50 - 130 Mio t. Da größtenteils nur geringmächtige Überdeckung vorliegt, kann die Gewinnung im Tagebau erfolgen. Die übrigen Vorkommen, wie z.B. am Jebel Barok oder Jebel Magrun, sind mit den Lagerungsverhältnissen vom Jebel Umm Ali vergleichbar. Ihre laterale Ausdehnung liegt jedoch meist unter hundert Metern, so daß eine Gewinnung unwirtschaftlich ist.
Der Kaolin von Salawa wird derzeit lediglich für die Herstellung weißer Tünche für den Hausanstrich lokal genutzt. Die nutzbaren Vorräte dürften 30.000 t nicht übersteigen. Auch hier kann aufgrund der geringmächtigen Überdeckung eine wirtschaftliche Gewinnung im Tagebau erfolgen. Durch die unmittelbare Nähe zum Nil stünde für eine eventuelle lokale Naßaufbereitung auch ausreichende Mengen an Wasser zur Verfügung. Der Transport des Kaolins zu Produktionsstätten in Shendi oder auch nach Khartoum per LKW ist unproblematisch. Eine systematische Untersuchung der näheren Umgebung nach weiteren Kaolinvorkommen ist nach eigener Einschätzung nach erfolgversprechend.