5.2 Ausgangsgesteine
Bei der Rekonstruktion der Ausgangsgesteine kann das Hallberg-Diagramm für sekundäre Kaoline nur Tendenzen aufzeigen. In der Abb. 104 sind die Mittelwerte für Zirkonium und Titan sämtlicher Proben aufgetragen. Danach wird den lateritischen Verwitterungsprodukten vom Jebel Tawiga, entsprechend den geologischen Befunden im Gelände, ein basisches bis intermediäres Ausgangsgestein zugeordnet. Auch für die Kaoline von Gedaref kann ein basisches bis intermediäres Ausgangsgestein angenommen werden während die "Hochflut-Kaoline" tendenziell im intermediären bis sauren Bereich liegen. Die Alterationsprodukte von Derudeb, denen eine metarhyolithisches Ausgangsgestein zu Grunde liegt, zeigen im Diagramm ein etwas zu geringes Zr:Ti-Verhältnis.
Neben Titan und Zirkonium können bestimmte Spurenelemente zusätzliche Hinweise für eine Bestimmung der Ausgangsgesteine liefern. So sind beispielsweise Cr, Ni, Cu und Zn in basischen und ultrabasischen Gesteinen am häufigsten vertreten (RÖSLER 1988). Dementsprechend zeigen auch die hauptsächlich über Metabasalten entwickelten Flintclays vom Jebel Tawiga im Vergleich zu den übrigen Vorkommen die höchsten Konzentrationen für diese Elemente (Abb. 105). Bei den Gedaref-Kaolinen muß allerdings berücksichtigt werden, daß die ursprünglichen Elementkonzentrationen infolge der sekundären Silifizierung im Durchschnitt um ca. 40% vermindert erscheinen.
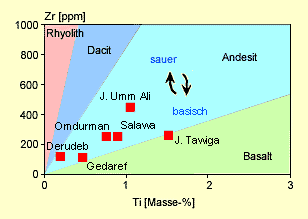
Abb. 104: Mittelwerte der Zr:Ti-Verhältnisse von primären und sekundären Kaolinen.
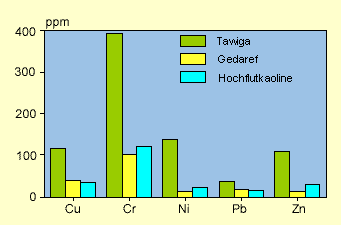
Abb. 105: Schwermetallkonzentrationen in den Kaolinen.
Beim Vergleich der durchschnittlichen Häufigkeiten der Spurenelemente in sauren und basischen magmatischen Gesteinen lassen sich für bestimmte Elemente größere Konzentrationsunterschiede erkennen. Diese Differenzen sollten sich auch in den Verwitterungsprodukten, trotz unterschiedlicher An- und Abreicherungstendenzen, in der Summe widerspiegeln. Größere Konzentrationsunterschiede zwischen sauren und basischen Gesteinen zeigen die Elemente Th, Zr, Rb einerseits und Ni, Cr, Cu und Zn andererseits. Um diesen Sachverhalt für Verwitterungsprodukte empirisch zu überprüfen, wurden zunächst die genannten Elementkonzentrationen für in-situ-Kaoline, die sich auf Granodiorit (Wiesa-Ost bei Kamenz) und Quarz-Porphyr (Fuchsberg-Süd bei Halle) sowie Saprolithe und Laterite, die sich über Basalt gebildet haben, diskriminiert. Zusätzlich wurden in die beiden "Testgruppen" auch die als sicher geltenden basaltderivaten Lateritproben vom Jebel Tawiga (n = 18) sowie Verwitterungsprodukte über Granitoiden (n = 4) vom Jebel Tawiga miteinbezogen. Unter Verwendung der zwei ermittelten Diskriminanz-Funktionen wurden die Werte sämtlicher Proben in ein Diskriminierungs-Diagramm aufgetragen (Abb. 106).
[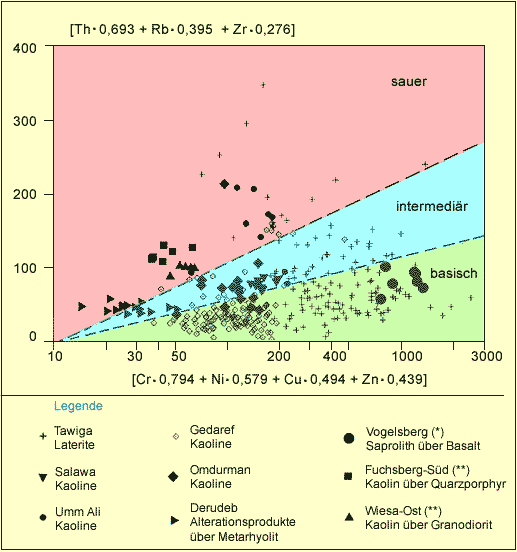
Abb. 106: Diskriminierungs-Diagramm zur Rekonstruktion
der Ausgangsgesteine
(RFA-Daten: * SCHWARZ 1994, pers. Mitt., ** KRUMB 1994, pers. Mitt.).
Anhand der Testproben lassen sich drei Felder definieren, die Verwitterungsprodukten mit sauren, intermediären sowie basischen bis ultrabasischen Ausgangsgesteinen entsprechen. Hierdurch wird eine ähnliche Probenzuordnung wie im Hallberg-Diagramm erreicht. Die Werte für die Gedaref-Proben müssen wegen des Verdünnungseffekts der Silifizierung nach rechts oben verschoben werden, so daß die tatsächlichen Werte größtenteils im Bereich zwischen den Salawa- und Tawiga-Proben liegen. Dies würde einem basischen bis intermediären Ausgangsgestein entsprechen. Das Ergebnis macht deutlich, daß außer Zirkonium und Titan auch jene Elemente für die Rekonstruktion der Ausgangsgesteine geeignet sind, die in sauren bzw. basischen Gesteinen am stärksten angereichert werden. Die Daten müssen jedoch mit Hilfe der Diskriminanzanalyse bearbeitet werden.